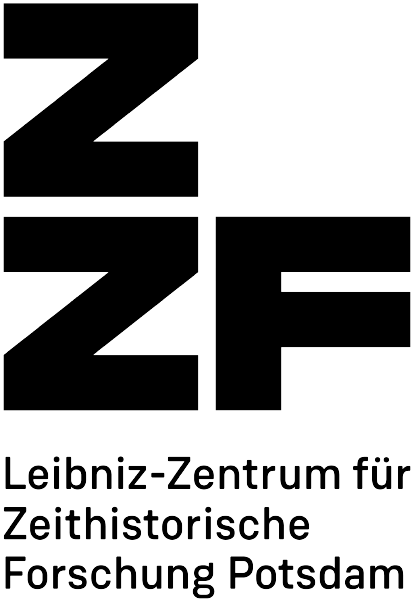Friedensforschung und Gewalt. Zwischen entgrenzter Gewaltanalyse und epistemischer Gewaltblindheit
- In der Gegenwart werden geradezu eruptiv und medial befeuert »alte« Gewaltphänomene zu Tage gefördert: Die Kampagne »#MeToo« lässt ein soziales Gewaltproblem sichtbar werden, welches lange Jahre ahnungsvoll präsent war, ohne im Detail öffentlich-politisch oder auch durch die Friedensforschung angemessen adressiert worden zu sein. Gleichzeitig drohen die Machthaber von Atomwaffenstaaten unverblümt mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, während weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit autonome Waffensysteme entwickelt werden, die gar nicht mehr auf eine/n Gewalttäter*in angewiesen sind, sondern allein aufgrund von dafür entwickelten Algorithmen Gewalt anwenden und Menschen töten. Bei einem derart entgrenzten Gewaltverständnis hat die Friedensforschung alle Hände voll zu tun, die unterschiedlichen Gewaltphänomene der Gegenwart im Blick zu behalten, über deren Entstehungsbedingungen aufzuklären und Ansätze zu ihrer Eingrenzung oder Überwindung zu entwickeln. Doch verdeutlichen die genannten Beispiele, dass auch die Friedensforschung nicht ohne weiteres aus den »Denkcontainern« der jeweiligen Gegenwart aussteigen kann und deshalb nicht vor epistemischer Gewaltblindheit, der wissenschaftlichen Unaufmerksamkeit für gesellschaftlich bedeutsame Gewalterfahrungen, gefeit ist. Wie bearbeitet die Friedensforschung das Spannungsverhältnis zwischen entgrenzter Gewaltanalyse einerseits und epistemischer Gewaltblindheit andererseits? Welche Rolle spielt dabei ihre Abhängigkeit von staatlicher finanzieller Förderung? Welche Gewaltverhältnisse werden aus welchen Motiven untersucht – und welche nicht? Ein Blick in die Geschichte der bundesdeutschen Friedensforschung kann hier erhellend wirken.
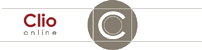 ZZF - Clio Lizenz
ZZF - Clio Lizenz