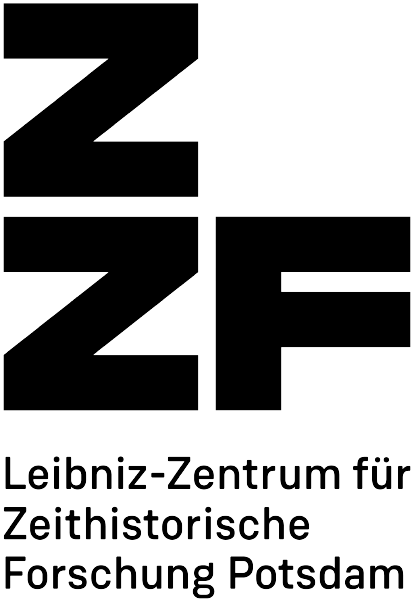Gewalt
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (101)
- Online Publication (48)
- Part of a Book (10)
- Book (2)
Keywords
- Begriffe (1)
- Deutschland (Bundesrepublik) (1)
- Dossier (1)
- Einzeltäter (1)
- Forschungsfelder (1)
- Geschichte 1949-1990 (1)
- Gewaltdarstellung (1)
- Graphic Novel (1)
- Grossman, Vasilij: Za pravoe delo (1)
- Historiker (1)
Wassili Grossmans Roman »Stalingrad« ist ein besonderes literarisches und historisches Dokument. Dem deutschen Lesepublikum eröffnet das Werk erstmals in einer für die Entstehungszeit erstaunlichen Vielstimmigkeit, Drastik und Breite Zugang zu sowjetischen Erfahrungshorizonten und Sichtweisen auf Stalingrad. Als Kontrastfolie zum Kult um die Schlacht in Putins Russland und zur nationalpatriotischen Instrumentalisierung des »Großen Vaterländischen Krieges« für den Krieg gegen die Ukraine hat der Roman außerdem eine unmittelbare Aktualität. Und nicht zuletzt handelt es sich hier um ein literarisches Zeugnis der jüdischen Geschichte.
Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland nehmen alle Bundesregierungen für sich in Anspruch, eine auf Frieden ausgerichtete Politik zu verfolgen. In Zeiten des Ost-West-Konflikts unterstützten sie in Afrika, Asien und Lateinamerika häufig aber auch autokratisch oder diktatorisch regierte Staaten mit fragwürdiger Menschenrechtsbilanz – darunter das seit 1962 unabhängige Ruanda. 1994 ließ dort eine verbrecherische Elite Hunderttausende Tutsi ermorden. Die Bundesregierung hatte die am Genozid beteiligte ruandische Armee zwischen 1978 und 1994 durch eine Bundeswehr-Beratergruppe in Kigali unterstützt. Schon zuvor hatte es Ausrüstungs- und Ausbildungshilfen gegeben. Die Auswertung kürzlich offengelegter Ministerialakten zeigt allerdings, dass die Bundesministerien weniger an einer Effizienzsteigerung der ruandischen Streitkräfte oder an einer Demokratisierung interessiert waren. In der Logik des Ost-West-Konflikts versuchten sie mit geringen Ressourcen gute Beziehungen zu pflegen und sich Rückhalt für eigene Positionen zu sichern. Aufgrund außenpolitischer Abwägungen hielt die Bundesregierung auch nach 1990 an der Militärkooperation fest. Von der Eskalation zum Genozid wurde sie überrascht.
Ein Mann im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit sichtbar eingenässter Jogginghose, den rechten Arm unzweideutig erhoben: Diese ikonische Fotografie ist eines der bekanntesten Bilder des rassistischen Pogroms in Rostock-Lichtenhagen, bei dem im August 1992 hunderte Gewalttäter über mehrere Tage Arbeitsmigrant:innen aus Vietnam und Asylsuchende im sogenannten Sonnenblumenhaus angriffen. Der Literaturwissenschaftler Matthias N. Lorenz verwendet die Aufnahme als Frontmotiv und Ausgangspunkt für seine Analyse der visuellen Erinnerung an die rechte Gewalt der deutschen Transformationszeit. Der schmale Band erscheint in der Reihe „Bildfäden“ des 2021 in Berlin gegründeten Schlaufen Verlags. Das Buch argumentiert zwar essayistisch zugespitzt, aber durchgehend wissenschaftlich und ist mit einem umfangreichen Fußnotenapparat ausgestattet.
Wie können Geschichten so erzählt werden, dass Leute sie hören wollen? Die Frage stellt sich allen, die ein Interesse daran haben, dass sich die Gesellschaft mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzt. Vor allem, wenn diese Geschichte schmerzhaft ist oder so lange zurückliegt, dass scheinbar keine Berührungspunkte zum aktuellen Leben mehr vorhanden sind. Eine mögliche Antwort darauf ist, aus der Geschichte wieder Geschichten zu machen – also den Regeln des Storytellings zu folgen und eine Dramaturgie aufzubauen. Wenn historische Geschehnisse nach diesen Regeln aufbereitet werden, sei es etwa literarisch oder filmisch, ist dem fertigen Produkt in der Regel nicht anzusehen, wo Leerstellen gefüllt wurden, um die Geschichte rund und interessant zu machen. Wird Geschichte in einer Graphic Novel erzählt, stellt sich die Frage nach Realitätstreue nicht in gleicher Weise. Denn die Zeichnung ist immer als ein künstlerisches Produkt erkennbar. Sie ist nicht mit der Realität zu verwechseln - die Form macht deutlich, dass hier mindestens eine Übersetzung stattgefunden hat.
Der Rechtsterrorismus in der Bonner Republik wird erstmals eingehend in seiner ganzen Bandbreite untersucht.
Der Rechtsterrorismus wurde in Deutschland jahrzehntelang als Problem für die innere Sicherheit unterschätzt. Das Bild vom verwirrten Einzeltäter prägte den Diskurs. Erst die Aufdeckung der Morde des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) machte Politik und Gesellschaft die unmittelbare Gefahr bewusst. Auch die bundesdeutsche Zeitgeschichte befasste sich lange kaum mit dem Rechtsterrorismus, obwohl dessen Geschichte bis in die frühen 1960er Jahre zurück reicht.
Darius Muschiol untersucht anhand vielfältiger Akten und Dokumente den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des bundesdeutschen Rechtsterrorismus bis 1990. Er blickt auf die Radikalisierungsprozesse der Rechtsterroristen, deren Vernetzungen, ihr Agieren und die Bewertung dieser Gewalt durch Politik, Justiz und Öffentlichkeit. Zudem stehen die jeweiligen Feindbilder, die gesellschaftliche Einbettung des Terrorismus und dessen Kommunikationsstrategien im Vordergrund. Im Blick stehen dabei auch bekannte Gruppierungen und Ereignisse wie die »Wehrsportgruppe Hoffmann« oder das Oktoberfestattentat 1980, vor allem aber zahlreiche bislang kaum oder unbekannte Akteure. Ebenso zeigt der Autor die gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Reaktionen. Dabei arbeitet er insbesondere heraus, dass es sich eben nicht um Einzeltäter handelte, sondern dass gerade diese Sicht die Gewalt verharmloste. Darius Muschiol ergänzt damit den Blick auf die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik wesentlich.
„Geschichte ist oft bilderlos.“ – Damit stellt sich die Frage, wie man in der Präsentation und Vermittlung von Geschichte mit bildlichen Überlieferungslücken umgeht? Es stellt sich aber auch die Frage nach dem Umgang mit überlieferten Bildern, die aus rassistischen, diskriminierenden oder ethischen Gründen nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gezeigt werden sollten. Wie visualisiert man also Ereignisse, die nicht oder nur bedingt bildlich darstellbar sind? Diesen und weiteren Fragen ging ein dezidiert interdisziplinär ausgerichteter Workshop am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung unter dem Titel „Was man nicht sieht! Perspektivwechsel durch Comics“, geleitet von Christine Bartlitz (Potsdam) und Irmgard Zündorf (Potsdam) nach.
Wie die historische Forschung zur deutschen und belgischen Kolonialgeschichte nachgewiesen hat, wurde die „Ethnifizierung“ (oder „Ethnogenese“), die im Zuge der Kolonialisierung zur polarisierenden Trennung von „Hutu“, „Tutsi“ und „Twa“ führte, schrittweise in die ruandischen Mentalitäten eingespeist, wo sie zur Grundlage der Identifizierung der prospektiven Opfer gemacht wurde. Da Genozide nicht möglich sind, wenn nicht zuvor die Frage nach der Identifizierung der zu Vernichtenden „geklärt“ ist hat die europäische Kolonialgeschichte als Vorgeschichte des Tutsizids zu gelten. Koloniale Akteure aus Deutschland spielten bei diesem Prozess eine Rolle. In der deutschen Kolonialfotografie lässt sich beobachten, dass das koloniale Bestreben, „Ordnung“ in die Begegnung mit der ruandischen Kultur und Gesellschaft zu bringen, ab Ende des 19. Jahrhunderts Eingang in die koloniale Fotografie fand.
Manche Bilder sind versehen mit Legenden, in denen sich die Ethnifizierung erkennen lässt. Die Anthropologen gingen davon aus, dass sich wissenschaftliche Beweise für die Existenz von drei klar voneinander abgegrenzten „Ethnien“ erbringen ließen. In Wirklichkeit herrschten Spekulationen und grundlegende Missverständnisse bezüglich der demografischen Struktur des fremden Landes vor. Zweifellosigkeiten wurden behauptet, und das in einem Land, mit dem zuvor nicht die geringsten Kontakte bestanden hatten. Es kam zu einer Vielzahl von Missverständnissen und Fehlinterpretationen, die dem kolonialen Überlegenheitsgefühl der deutschen Fotografen geschuldet waren.
„It’s a Date” ist der erste Spielfilm der ukrainischen Regisseurin Nadia Parfan, die bereits durch ihre Dokumentarfilme bekannt geworden ist. Der fünfminütige Kurzfilm läuft auf der diesjährigen Berlinale in der Sektion Berlinale Shorts. It's a Date wurde aus der Perspektive eines/einer Autofahrer:in in einer einzigen Einstellung ohne Schnitt gedreht. Der Blick ist durch die Windschutzscheibe auf die Straßen von Kyjiw im Morgengrauen gerichtet, inmitten des Krieges. Wie Nadia Parfan selbst erklärt, wurde sie für diesen Film von Claude Lelouch inspiriert, der in seinem Kurzfilm aus dem Jahr 1976 „C’était un rendez-vous“ eine rasante Autofahrt durch das frühmorgendliche Paris zeigt. Nadia Parfan wollte einen ähnlichen Kurzfilm in Kyjiw drehen, noch vor dem russischen Angriffskrieg, konnte dies aber erst im Sommer 2022 machen.
Mariupol, Irpin, aktuell Butscha – der russische Überfall auf die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 führt zu immer neuen grauenvollen Bildern dieses völkerrechtswidrigen Krieges. Mit jedem Ortsnamen werden wir von nun an die verstörenden Fotografien von den Frauen aus der angegriffenen Geburtsklinik in Mariupol, die tote Mutter mit ihren beiden Kindern in Irpin und die ermordeten Zivilist:innen auf den Straßen von Butscha vor Augen haben.
Den visuellen Medien kommt bei der Berichterstattung über diesen Krieg, bei der Deutung wie auch bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen eine zentrale Rolle zu. Die Macht der Bilder als gestaltende und mobilisierende Kraft im politischen Prozess wie auch als Fakten schaffender „Bildakt“ (Horst Bredekamp) war in Kriegszeiten schon immer groß.
Russlands Krieg gegen die Ukraine enthüllte nicht nur den imperialen Großmachtanspruch herrschender Eliten in Russland, sondern auch ein generelles kulturelles Überlegenheitsgefühl gegenüber Ukrainer:innen. Darüber hinaus beklagen immer wieder Stimmen aus Kasachstan, Georgien und Usbekistan den kolonialistischen Habitus einiger geflüchteter Russ:innen. Diese Einstellungen haben ihre Wurzeln im russländischen Imperium, denn die Revolution und Gründung der Sowjetunion brachen nur bedingt mit dem imperialen Erbe des Zarenreiches. Spätestens seit den 1930er Jahren stand, nach einigem nationalpolitischen Hin- und Her, das russische Volk auch in öffentlichen Diskursen an der Spitze der sowjetischen Völker. In einem kurzen, aber besonders repräsentativen Beispiel möchte ich zeigen, wie in der Zwischenkriegszeit diese Hierarchisierung durch öffentlich publizierte Fotografien suggestiv vermittelt wurde.