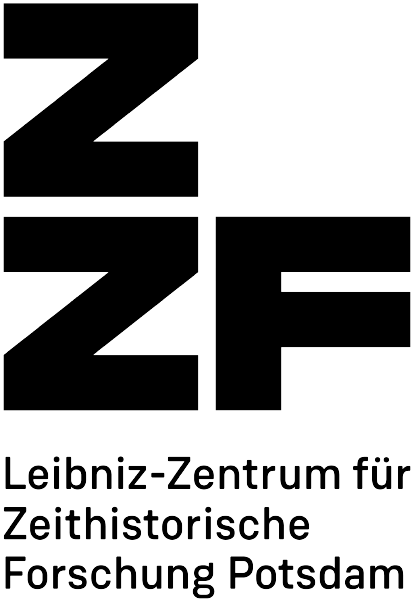Literatur
Refine
Year of publication
Document Type
- Journal Article (25)
- Part of a Book (10)
- Online Publication (8)
- Book (1)
Keywords
- Deutschland (DDR) (1)
- Geschichte 1946-1970 (1)
- Grossman, Vasilij: Za pravoe delo (1)
- Literaturpolitik (1)
- Mitteldeutscher Verlag (1)
- Schnittmengen (1)
- Zensur (1)
Wassili Grossmans Roman »Stalingrad« ist ein besonderes literarisches und historisches Dokument. Dem deutschen Lesepublikum eröffnet das Werk erstmals in einer für die Entstehungszeit erstaunlichen Vielstimmigkeit, Drastik und Breite Zugang zu sowjetischen Erfahrungshorizonten und Sichtweisen auf Stalingrad. Als Kontrastfolie zum Kult um die Schlacht in Putins Russland und zur nationalpatriotischen Instrumentalisierung des »Großen Vaterländischen Krieges« für den Krieg gegen die Ukraine hat der Roman außerdem eine unmittelbare Aktualität. Und nicht zuletzt handelt es sich hier um ein literarisches Zeugnis der jüdischen Geschichte.
As cultural products, images are infused with notions of gender – notions, which are, of course, specific to the times and places in which these images originate. For gender historians, they are fascinating artefacts, but often also frustratingly difficult to interpret. This dossier presents the work of historians who look at gender through visual sources. The contributors engage with a wide variety of visual sources (including book illustrations, posters, photographs, and comics) to explore gender history in a range of places and moments in time. Our aim is to examine how historical actors have used images as they negotiate gender, and how we as historians can incorporate these images into our analyses of gender history. Not surprisingly we have discovered that working with images as historians is complicated – even more complicated than working with more conventional text-based sources – but that it is also fascinating and fun. So, we still want to do it!
My analysis of ambivalent representations of gender and sexuality in children’s book illustrations centers on publications for middle-class German readers between 1776 and 1845 – a somewhat overlooked yet foundational milieu of modern children’s literature. I have found that these images at times invoke hegemonic ideas about gender while at others deviate from those norms – occasionally even within the same text. Materials created explicitly for children and youth offer special insight into ideologies such as those that structure gender and sexuality. This is true both because they can be more heavy-handed in their ideological messages – with a mind toward what is appropriate for the child viewer – but also because they remind us of the limits of didacticism when we consider the young reader’s/viewer’s unpredictable response. Thus, ambiguity is itself a characteristic of the gendered values presented in children’s books. At various historical moments, children’s illustrations upheld expectations of adult visual culture while breaking or sidestepping others.
In this text, Katja Stopka argues for closer cooperation between historical and literary studies, both of which are text-based disciplines that work in ways oriented towards source materials and yet remain critical of the textual foundations on which they stand. History and literary researchers take writing and reading as their subject of inquiry; they collect and organize archives of written records, use these archives as repositories of knowledge, and in turn draw on these holdings, for example in critical examinations of cultural patterns of reflection, or historical perceptions in need of correction.
Eine aufschlussreiche Debatte um die Frage nach der Beeinträchtigung der deutschen Sprache durch die NS-Zeit fand 1963 in Walter Höllerers zwei Jahre zuvor gegründeter Zeitschrift »Sprache im technischen Zeitalter« statt. Hier wurden drei Beiträge aus dem englischsprachigen Ausland dokumentiert, von denen George Steiners Essay »Das hohle Wunder« besonders heftige Antworten provozierte. Unser Aufsatz rekapituliert Steiners sprachkritische Intervention im Rahmen des damaligen literarischen Resonanzraums und untersucht zunächst Auffälligkeiten der unautorisierten ersten Übersetzung von Steiners Text. Im Zentrum steht dann die Kritik der um Repliken gebetenen Autorinnen und Autoren, unter denen mit Hilde Spiel, Marcel Reich-Ranicki, François Bondy und Hans Weigel mehrere jüdische Persönlichkeiten waren. Wir diskutieren, warum diese dem Befund Steiners widersprachen und ihr Vertrauen in die deutsche Sprache bekundeten. Der Aufsatz schließt mit Wolfgang Hildesheimer, dessen Blick auf das Deutsche als Tätersprache durch seine Arbeit als Übersetzer bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen geprägt war.
Anlässlich des 80. Geburtstages von Franz Kafka hatte vom 27. bis 29. Mai 1963 im barocken Schloss von Liblice die inzwischen legendäre Kafka-Konferenz unter der Federführung von Eduard Goldstücker und seiner Prager Germanistenkollegen stattgefunden. Ein Jahr danach, im Sommer 1964 berichtete der Budapester Korrespondent der Associated Press über die kulturpolitische Situation in den osteuropäischen Ländern. Unter dem Titel „Wer wird sich schon vor Kafka fürchten?“ diagnostizierte der Autor ein „kulturpolitisches Tauwetter“, das insbesondere in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen zu spüren sei.
Als vor gut zehn Jahren meine Studie über „Das Schicksal der DDR-Verlage“ im Prozess der deutschen Vereinigung erschien, gab es große mediale Aufregung über die Resultate. Die Zahlen waren tatsächlich erschütternd: Von den ehemals 78 staatlich lizenzierten Verlagen der DDR existierte 2006 in eigenständiger Form nur noch ein Dutzend, was etwa 15% entsprach. Nach Wirtschaftskraft betrachtet, waren die ostdeutschen Verlage inzwischen fast vollständig zu vernachlässigen: Am Gesamtumsatz der deutschen Buchbranche von damals 10,7 Mrd. € waren Firmen aus den neuen Bundesländern (ohne Berlin) 2006 nur noch mit 0,9 % beteiligt.
Das Erschrecken war nicht nur deshalb so groß, weil selbst die meisten Branchenteilnehmer einen gefühlt anderen Eindruck hatten, sondern weil die Verlagsbranche damit noch unter dem Ergebnis anderer Wirtschaftsbereiche Ostdeutschlands lag, denn nach Treuhandangaben sind dort insgesamt rund 20% der Betriebe erhalten geblieben.
Schaut man sich die Situation heute an, hat sich die Lage keineswegs verbessert. Zwar haben einige Verlage ihren Sitz nach Berlin verlagert und sind ein paar neugegründete Kleinstverlage hinzugekommen, doch die Gesamtlage hat sich kaum verbessert. An der Gesamttitelproduktion sind die ostdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) nach wie vor nur mit insgesamt 5% beteiligt.
Geschichtszeichen gehen von einer gewissen geografischen oder historischen Ferne aus, von der man ein Ereignis (z.B. die Französische Revolution von Königsberg aus) betrachtet und als erhabenes Zeichen eines Wendepunkts in der Geschichte begreift. 1940 veröffentlichte der Militärhistoriker Felix Hartlaub seine Dissertation: »Don Juan d’Austria und die Schlacht bei Lepanto«. Hierin konstruiert er die Seeschlacht der siegreichen Abwehr des Osmanischen Reichs im Jahr 1571 als Geschichtszeichen. Doch während seiner Tätigkeit als Kriegstagebuchschreiber im »Führerhauptquartier Wolfsschanze« (1943-1944) erlebte er das Militär aus zu großer Nähe, sodass der Geist seines Heldenepos in den letzten Jahren des Krieges von seiner Erfahrung im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) regelrecht zerschreddert wurde. Die Neuausgabe seines »Lepanto-Buchs« erfährt in den letzten Jahren eine große Resonanz im Lager der Neuen Rechten. Man geht auf Tuchfühlung mit einem Geschichtszeichen, von dem man sich eine mythische Ausstrahlung erhofft.
Der Aufsatz präsentiert die multimediale Geschichte des Romans, Hörspiels und Fernsehfilms »Am grünen Strand der Spree«, die zwischen 1955 und 1960 in Westdeutschland publiziert wurden. Darin schildern der Autor Hans Scholz bzw. die Regisseure Gert Westphal und Fritz Umgelter unter anderem die Massenerschießung von Juden in der sowjetischen Stadt Orscha im Herbst 1941. Der Romanautor beteuerte, die Beschreibung basiere auf seinen eigenen Kriegserinnerungen, und nahm für sich die Position eines Augenzeugen in Anspruch. Zugleich passte er das Bild des Verbrechens an die mutmaßlichen Erwartungen seiner Leser*innen an. Ähnlich agierten die Regisseure des Hörspiels und Fernsehfilms. Jede Version entfernte sich von den Ereignissen, die während des Ostfeldzugs tatsächlich stattfanden, und ähnelte zunehmend den Erzeugnissen der bundesdeutschen Erinnerungskultur, die Leid und Heldentum deutscher Soldaten in den Vordergrund stellte. Nichtsdestotrotz hielten die Rezipient*innen – darunter zahlreiche Kriegsveteranen – die Szene aus Orscha für besonders »authentisch«. Anhand von Aussagen in zeitgenössischen Besprechungen, Briefen und Interviews wird die Vorstellung von angeblich »authentischen Kriegsbildern« in der Bundesrepublik diskutiert.
In 1892, the year the American writer Pearl S. Buck was born, the US Congress renewed the Chinese Exclusion Act, initially passed in 1882, for another ten years. It sought to prevent all laborers of Chinese ethnicity from entering or reentering the US, with breaches punishable by law. Three months after her birth, Buck moved with her missionary parents to China and spent most of her life until her early forties there. During the global Cold War, Buck, already a Nobel Laureate (1938), sharply criticized US foreign policy and its racism, the ignorance of American diplomats about China, and the arrogant belief in solving conflicts in Asia through military means in her book Friend to Friend (1958). While there is little doubt about Buck’s official US nationality, her cultural belonging of choice – which decisively shaped her lifelong literary writing, in particular the novel The Good Earth (1931) that earned her the Nobel Prize – is inherently multivalent. In The Good Earth, Buck depicts the lives of Chinese peasants and their loyalty to the earth that nurtures humanity and provides all that lives on it with nutrition. In the following pages, I will discuss Buck’s bicultural biography and several aspects of this extremely popular and influential novel and, rather than viewing it as a piece of classic American literature, I will propose re-reading it as a work in the Chinese tradition of literary realism and in the context of the emerging trend of rural realism in the early twentieth century. The purpose of my re-reading of The Good Earth is to highlight less apparent global connections in the tradition of rural nostalgia and to complicate the paradigm of national literature and national history. Indeed, the earth, ruralism, nutrition, and food, as the novel describes, constitute the very foundation of human existence across borders, political camps, language barriers, and cultural differences from antiquity to the present day.