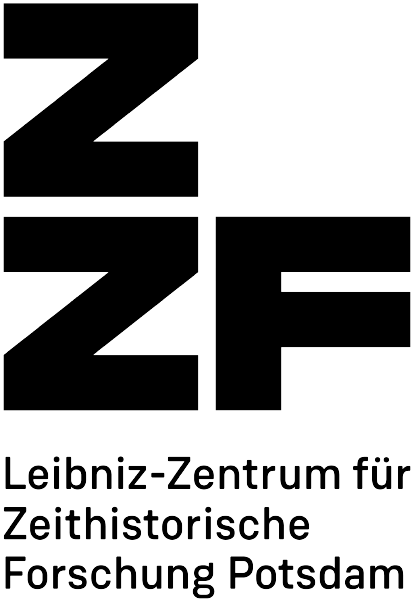Furor und Wissenschaft Vierzig Jahre nach „1968“
- Seit dem von Ingrid Gilcher-Holtey 1998 herausgegebenen Sammelband, der das schillernde Ereignisbündel „1968“ erstmals systematisch historisierte, hat sich die deutsche Geschichtswissenschaft diesem Thema eingehend zugewendet. Zehn Jahre später gibt der Publikationsschub zu dem neuerlichen runden Jahrestag Anlass zu einer Zwischenbilanz. Das auffälligste Ergebnis ist dabei die im Grunde banale Erkenntnis, dass auch die historiographische Perspektive weder „objektiv“ noch homogen ist, sondern von wechselnden, zum Teil konkurrierenden Konjunkturen nationaler und zunehmend auch internationaler Geschichtskulturen beeinflusst wird. Dass der Wissenschaftsanspruch mit der Involvierung der Akteure in die Konflikte der Gegenwartsgesellschaft strukturell kollidiert, gehört zu den Selbstverständlichkeiten zeithistorischer Forschung. Dies gilt nicht nur für ehemalige Akteure, deren Beteiligung häufig bekannt ist und in die Bewertung ihrer publizistischen Produktion einfließt. Auch der angebliche Objektivitätsvorsprung der so genannten „Nachgeborenen“ macht deren empathische Distanz nicht automatisch wett, sondern erweist sich erst in der diskursiv zu ermittelnden Überzeugungskraft des jeweiligen Produkts. Insofern ist die Kontroverse um die aktuellen Neuerscheinungen zu begrüßen, während die immer wieder repetierten Hinweise auf die generationelle Zugehörigkeit ihrer Autoren in den Nebel vager Evidenzen führen. Dass sich beim Thema „1968“ professionelle Intellektualität und autobiographische Motive stark vermischen, ändert daran nichts.
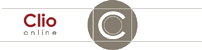 ZZF - Clio Lizenz
ZZF - Clio Lizenz